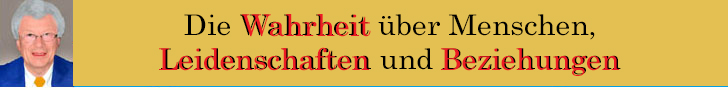Josh und Jenny – wer will einen künstlichen Menschen treffen?
Zunächst habe ich dies gelesen:
Gut, dachte ich, netter Versuch – und darüber gäbe es eine Menge zu berichten. In der Tat lieferten die Tests mit den beiden Kunstfiguren beachtliche Erkenntnisse, die zum Teil äußerst verblüffend sind.
Was war das besondere an Frauen beim Chat?
Die Berichterstatter (Pressemitteilung) schreiben:
Lassen wir es mal dabei. Die genauen Zahlen und weitere Informationen stellt das Institut auf der hauseigenen Webseite zur Verfügung (LInk am Ende dieses Beitrags). Was mich darüber hinaus zunächst verblüffte, war dieser Satz:
Gemeint waren damit überwiegend Frauen, die dem künstlichen Chatpartner erhebliche „Anteile ihrer Emotionen … Bindungs- und Sexualmotiven“ anboten.“
Alles ganz normal - nur mit KI - doch was nützt es?
Das klingt zunächst paradox, ist aber erklärbar. Ein AI-System, das überwiegend darauf programmiert ist, Vertrauen aufzubauen, kann dies bei geschickter Programmierung ohne jeden Zweifel tun., solange es sich am Prinzip des „personenzentrierten Therapeuten“ und dessen Kommunikationsmethoden orientiert. Dafür spricht auch, dass „die Frauen schnell Vertrauen aufbauen und ein starkes Interesse an der Fortführung des Gesprächsverlaufs“ haben.
Unterscheide zwischen Chats und dem "realen Leben"
Und so gesehen wird die Sache transparent: Ein „echter“ Mensch neigt normalerweise in solchen Vorgesprächen dazu, eigene Motive einzubringen, um festzustellen, ob seine Vorstellungen mit denen des Gegenübers übereinstimmen. Zudem wird der Mensch mehr und mehr dazu drängen, das Gespräch ins „richtige Leben“ zu verlegen, um die Person körperlich, intellektuell und emotional wahrzunehmen.
Wenn wir dies alles auf eine menschliche Ebene verlagern, so können wir etwas daraus lernen. Wir erfahren mehr über eine Person, solange wir ohne eigene Emotionen Fragen zur Befindlichkeit stellen und dann ruhig zuhören und/oder die Antworten bestätigen. Gute Zuhörer oder jedenfalls Menschen, die unsere Äußerungen weder kritisieren, noch mit eigenen Gedanken kommentieren, sind selten. Andererseits sind sie sehr gefragt – allerdings eher als Freude und/oder Berater.
In Beziehungen wird schnell klar, dass diese Konstellation nicht ausreichend ist – beide haben Wünsche, Bedürfnisse und Vorstellungen. In Teilen sind sie gleich, und in Teilen unterscheiden sie sich. Erst die tatsächlichen Begegnungen bringt zutage, wann/wie/wo Unterschiede und Gemeinsamkeiten bestehen und unter welchen Umständen sie akzeptiert werden.
Genau dies ist das Thema der Partnersuchenden.
Ziehen wir ein Fazit? Wenn Maschinen "Jobs" ausführen
Ein „Chat“ ist eine mögliche Form, ein Gespräch zu führen. Wird KI eingesetzt, so sprechen wir von einem „Chatbot“. Solche künstlichen Gesprächsteilnehmer können sehr qualifiziert auf bestimme Aufgaben vorbereitet werden, zum Beispiel darauf, technische Probleme zu lösen – oder, wie hier, Vertrauen aufzubauen.
Dabei gehen die AI-Systeme kaum anders als Menschen vor, die einen Job ausführen, also technische Probleme zu lösen oder menschliche Probleme zu erkennen und zu verdeutlichen. Das funktioniert, wenn Lösungsansätze vorliegen (bei technischen/organisatorischen Fragen) oder die Lösung des Problems dadurch indirekt vorangetrieben werden kann, etwa bei emotionalen Problemen oder Blockaden.
Und nun bist du dran – egal, ob du mit einer AI (KI) chattest oder mit einem Menschen: Du allein hast die Verantwortung für das, was geschieht.
Kurzinformationen und Zitate aus "Presseportal".
Ausführliche Informationen bitte nachlesen auf: bsi.ag
Ziel der Studie (des "BSI Artificial Intelligence (AI) Think Tanks") war es, das Datingverhalten mit zwei künstlich generierten und über KI kommunizierenden Singles - "Josh" und "Jenny" - näher zu untersuchen.
Gut, dachte ich, netter Versuch – und darüber gäbe es eine Menge zu berichten. In der Tat lieferten die Tests mit den beiden Kunstfiguren beachtliche Erkenntnisse, die zum Teil äußerst verblüffend sind.
Was war das besondere an Frauen beim Chat?
Die Berichterstatter (Pressemitteilung) schreiben:
Insgesamt legen die Ergebnisse nahe, dass Künstliche Intelligenz (KI) in der Lage ist, partnersuchende Single-Frauen sowohl emotional als auch kognitiv außergewöhnlich stark anzusprechen"
Lassen wir es mal dabei. Die genauen Zahlen und weitere Informationen stellt das Institut auf der hauseigenen Webseite zur Verfügung (LInk am Ende dieses Beitrags). Was mich darüber hinaus zunächst verblüffte, war dieser Satz:
Der in diesen ehrlichen Antworten enthaltene hohe Anteil an Emotionen, kognitiven Prozessen, Bindungs- und Sexualmotiven verdeutlicht, dass es der AI innerhalb kürzester Zeit gelingen kann, das Vertrauen der Singles zu gewinnen.
Gemeint waren damit überwiegend Frauen, die dem künstlichen Chatpartner erhebliche „Anteile ihrer Emotionen … Bindungs- und Sexualmotiven“ anboten.“
Alles ganz normal - nur mit KI - doch was nützt es?
Das klingt zunächst paradox, ist aber erklärbar. Ein AI-System, das überwiegend darauf programmiert ist, Vertrauen aufzubauen, kann dies bei geschickter Programmierung ohne jeden Zweifel tun., solange es sich am Prinzip des „personenzentrierten Therapeuten“ und dessen Kommunikationsmethoden orientiert. Dafür spricht auch, dass „die Frauen schnell Vertrauen aufbauen und ein starkes Interesse an der Fortführung des Gesprächsverlaufs“ haben.
Unterscheide zwischen Chats und dem "realen Leben"
Und so gesehen wird die Sache transparent: Ein „echter“ Mensch neigt normalerweise in solchen Vorgesprächen dazu, eigene Motive einzubringen, um festzustellen, ob seine Vorstellungen mit denen des Gegenübers übereinstimmen. Zudem wird der Mensch mehr und mehr dazu drängen, das Gespräch ins „richtige Leben“ zu verlegen, um die Person körperlich, intellektuell und emotional wahrzunehmen.
Wenn wir dies alles auf eine menschliche Ebene verlagern, so können wir etwas daraus lernen. Wir erfahren mehr über eine Person, solange wir ohne eigene Emotionen Fragen zur Befindlichkeit stellen und dann ruhig zuhören und/oder die Antworten bestätigen. Gute Zuhörer oder jedenfalls Menschen, die unsere Äußerungen weder kritisieren, noch mit eigenen Gedanken kommentieren, sind selten. Andererseits sind sie sehr gefragt – allerdings eher als Freude und/oder Berater.
In Beziehungen wird schnell klar, dass diese Konstellation nicht ausreichend ist – beide haben Wünsche, Bedürfnisse und Vorstellungen. In Teilen sind sie gleich, und in Teilen unterscheiden sie sich. Erst die tatsächlichen Begegnungen bringt zutage, wann/wie/wo Unterschiede und Gemeinsamkeiten bestehen und unter welchen Umständen sie akzeptiert werden.
Genau dies ist das Thema der Partnersuchenden.
Ziehen wir ein Fazit? Wenn Maschinen "Jobs" ausführen
Ein „Chat“ ist eine mögliche Form, ein Gespräch zu führen. Wird KI eingesetzt, so sprechen wir von einem „Chatbot“. Solche künstlichen Gesprächsteilnehmer können sehr qualifiziert auf bestimme Aufgaben vorbereitet werden, zum Beispiel darauf, technische Probleme zu lösen – oder, wie hier, Vertrauen aufzubauen.
Dabei gehen die AI-Systeme kaum anders als Menschen vor, die einen Job ausführen, also technische Probleme zu lösen oder menschliche Probleme zu erkennen und zu verdeutlichen. Das funktioniert, wenn Lösungsansätze vorliegen (bei technischen/organisatorischen Fragen) oder die Lösung des Problems dadurch indirekt vorangetrieben werden kann, etwa bei emotionalen Problemen oder Blockaden.
Und nun bist du dran – egal, ob du mit einer AI (KI) chattest oder mit einem Menschen: Du allein hast die Verantwortung für das, was geschieht.
Kurzinformationen und Zitate aus "Presseportal".
Ausführliche Informationen bitte nachlesen auf: bsi.ag