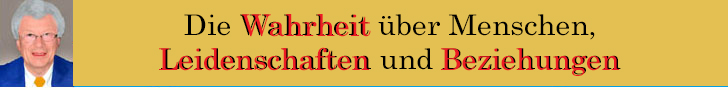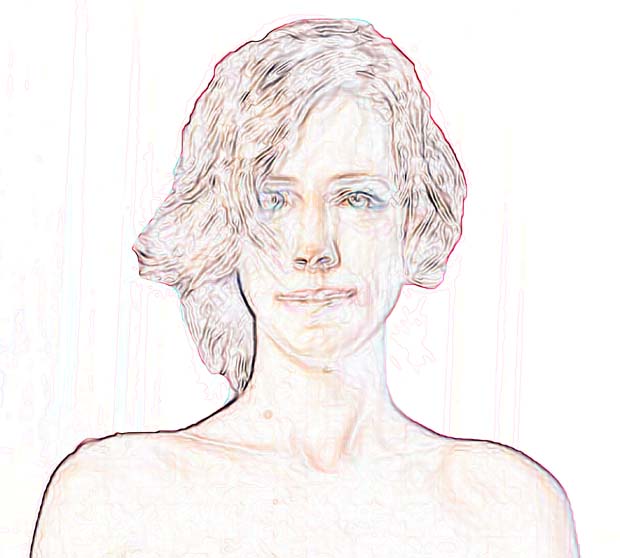Warum "Mann sein" so schwierig sein kann
Differenziertes Denken fällt vielen Menschen schwer, vor allem, wenn es um die Beurteilung des Zeitgeistes und seiner Auswirkungen geht. Kurz gesagt: Wir leben zwar alle in der gleichen Welt, aber wir haben durchaus unterschiedliche Sichtweisen darauf. Das allein wäre noch nicht einmal bemerkenswert. Wesentlich schwieriger ist, mit den Realitäten umzugehen. Und eine davon ist: Ein und dasselbe Phänomen kann man von zwei Seiten betrachten – und keine davon ist für sich genommen richtig oder falsch.
Männer erhalten widersprüchliche Botschaften - was bedeutet das?
Ich las einen umfassenden Artikel darüber, wie der heutige Mann in Mitteleuropa die Welt sieht, und ich zitiere zunächst diesen Abschnitt:
Im Gegensatz zum Autor dieser Zeilen denke ich einfacher: Männer müssen diese Spannungen eben aushalten. Und nicht nur Männer. Jeder, der sich als Mann, Frau oder etwas anderes definiert, muss sich diesen Mehrdeutigkeiten stellen.
Drei Gruppen von Männern - welche Bedeutung hat das?
Der Autor Markus Theunert, von dem der Satz stammt, teilt die Welt der Männer in drei Gruppen.
Eine (vermutlich die kleinste Gruppe) sei mit Argumenten nicht zu beeindrucken. Sie würde Frauen eine bestimmte Rolle zuweisen, etwa so, wie man dies in den 1950er/1960er-Jahren tat. Eine weitere Gruppe findet an der Gleichstellung durchaus gefallen – sie fühlt sich mehr oder weniger bestätigt. Doch darum geht es dem Autor nicht so sehr – er versucht, die unentschlossenen Männer zu erreichen – eigentlich kein „Drittel“, sondern eher der größere Teil.
Appelle aus der Soziologie - sinnvoll oder nicht?
Die Frage ist allerdings, was durch solche „wissenschaftliche“ Appelle erreicht werden kann. Die Soziologie steht immer wieder im Verdacht, mehr Forderungen zu stellen als Lösungen anzubieten. Denn das Positive, das sich auf lange Sicht ergeben könnte, ist dem Soziologen nicht genug - im Original:
Warum eigentlich nicht? „Soziale Gerechtigkeit“ ist eine Forderung, die einer Utopie ähnelt. Gleichstellung ist ein Verfahren, um das Leben aller an beschreibbare Normen anzugleichen. Und da wäre noch eine letzte Bemerkung: Menschen leben nach ihren individuellen Vorstellungen – Männer, Frauen und alle, die sich woanders einordnen.
Dennoch: Der Artikel in der Schweizer „Wochenzeitung“ ist in jedem Fall lesenswert. Die Zitate stammen alle aus dem Beitrag der WOZ(CH).
Männer erhalten widersprüchliche Botschaften - was bedeutet das?
Ich las einen umfassenden Artikel darüber, wie der heutige Mann in Mitteleuropa die Welt sieht, und ich zitiere zunächst diesen Abschnitt:
Viele Männer sind in einem Vakuum gefangen, weil sie widersprüchlichen Botschaften ausgesetzt sind: Die traditionellen Normen gelten weiterhin, es bleibt also alles wie immer. Hinzu kommen aber auch viele neue Normen, es soll also auch alles anders sein. So entsteht viel Verwirrung und Wut, weil die meisten Männer nicht wissen, wie sie mit dieser Spannung umgehen sollen.
Im Gegensatz zum Autor dieser Zeilen denke ich einfacher: Männer müssen diese Spannungen eben aushalten. Und nicht nur Männer. Jeder, der sich als Mann, Frau oder etwas anderes definiert, muss sich diesen Mehrdeutigkeiten stellen.
Drei Gruppen von Männern - welche Bedeutung hat das?
Der Autor Markus Theunert, von dem der Satz stammt, teilt die Welt der Männer in drei Gruppen.
Eine (vermutlich die kleinste Gruppe) sei mit Argumenten nicht zu beeindrucken. Sie würde Frauen eine bestimmte Rolle zuweisen, etwa so, wie man dies in den 1950er/1960er-Jahren tat. Eine weitere Gruppe findet an der Gleichstellung durchaus gefallen – sie fühlt sich mehr oder weniger bestätigt. Doch darum geht es dem Autor nicht so sehr – er versucht, die unentschlossenen Männer zu erreichen – eigentlich kein „Drittel“, sondern eher der größere Teil.
Appelle aus der Soziologie - sinnvoll oder nicht?
Die Frage ist allerdings, was durch solche „wissenschaftliche“ Appelle erreicht werden kann. Die Soziologie steht immer wieder im Verdacht, mehr Forderungen zu stellen als Lösungen anzubieten. Denn das Positive, das sich auf lange Sicht ergeben könnte, ist dem Soziologen nicht genug - im Original:
Gleichstellung lässt sich nicht von sozialer Gerechtigkeit trennen.
Warum eigentlich nicht? „Soziale Gerechtigkeit“ ist eine Forderung, die einer Utopie ähnelt. Gleichstellung ist ein Verfahren, um das Leben aller an beschreibbare Normen anzugleichen. Und da wäre noch eine letzte Bemerkung: Menschen leben nach ihren individuellen Vorstellungen – Männer, Frauen und alle, die sich woanders einordnen.
Dennoch: Der Artikel in der Schweizer „Wochenzeitung“ ist in jedem Fall lesenswert. Die Zitate stammen alle aus dem Beitrag der WOZ(CH).