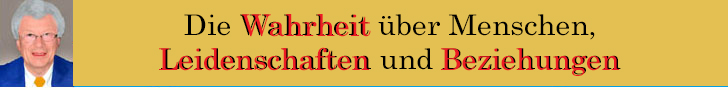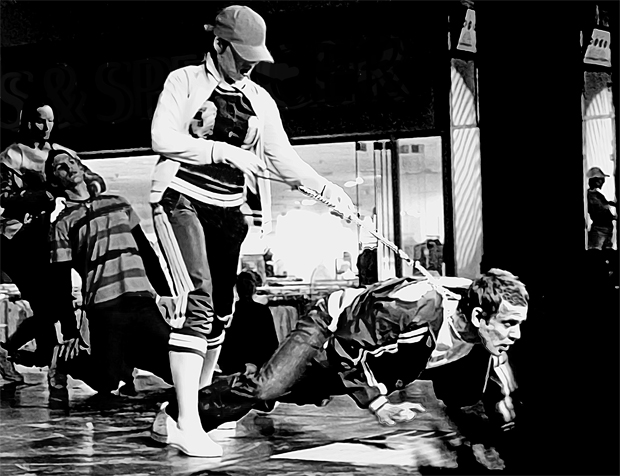Das Weibliche im Mann und die „Wissenschaften“ beruht auf den - meiner Ansicht nach höchst fragwürdigen - Forschungsergebnissen eines Wissenschaftlers, der bereist in das Online-Lexikon "Wikipedia" Eingang fand.
Bist du ein Mann? Dann hat ein US-amerikanischer Professor eine Neuigkeit für dich: Wenn du nicht ruppig genug bist und deine Männlichkeit herauskehrst, dann hast du etwas Weibliches in dir.
Nun ist die unwahrscheinlichste Annahme überhaupt, dass Männer nur „männliche“ Eigenschaften haben und Frauen ausschließlich weibliche. Im Kern haben wir beide Anlagen, bei Mann eben ein wenig mehr Männliche und bei der Frau eben ein wenig mehr Weibliche.
Die Queer-Theorie wird immer mehr zum „Maßstab“
Die Queer-Theorie hat uns alle ein bisschen „queerer“ gemacht. Und deswegen sind alle Jungs, die Freude an „weiblichen“ Interessen haben, nun (Wikipedia-Formulierung) „Hetero-Tunten“, oder nach der englischen Bezeichnung eben „Straight Sissy Boys“ – wobei „Sissy“ ein ebensolches Schimpfwort ist wie „Tunte“. Außerhalb der Queer-Theorie würde man dies als „blanken Unsinn“ bezeichnen, aber seit die sogenannten „Heterosexuellen“ fast ausschließlich aus der Sicht der Queer-Theorie beurteilt werden, müssen wir offenbar jeden Unsinn „schlucken“.
Einsatz für „Quere“ Menschen heißt: Du bist eigentlich auch „Queer?“
Du setzt dich dafür ein, dass Queere Menschen anerkannt und integriert werden? Wenn du ein Mann bis, dann heißt du ab sofort: „Social-justice straight-queer“. Mit anderen Worten: Wenn du sie verteidigst, hast du selbst solche Anteile. Was im Umkehrschluss heißt: Ein echter Mann will nichts mit „Schwulen“ zu tun haben. Ich frage mich, ob man den gleichen Unsinn auch Frauen zuschreiben würde, die sich für die Rechte homosexueller Frauen einsetzen.
Praktiken werden mit sexuellen Identitäten verwechselt
Wenn du dich nicht als homosexuell bezeichnest, aber mit einigen Praktiken kokettierst, wirst du zum „Elective straight-queer“. Das heißt, dass durchaus Praktiken magst, die als „schwul“ gelten, du dich aber emotional nicht zu Männern hingezogen fühlst. Dieses Thema klingt höchst brisant, ist aber völlig trivial. Denn eine sehr große Anzahl von Männern weiß durchaus, was „Pegging“ bedeutet und welche Gefühle Männer dabei haben können. Niemand hat etwas dagegen, wenn Typen mit „stahlharter Männlichkeit“ darauf verzichten – aber es hat wirklich wenig mit „Queer-Sein“ zu tun. Auch hier ergibt sich die Frage: Würde man jemals einer Frau solch ein Attribut zuweisen, wenn sie – beispielsweise – den Cunnilingus aktiv ausübt? Oder ihn lieber von einer Frau empfängt als von einem (unrasierten) Mann?
Die freie Wahl der sexuellen Praktiken als Verschärfung?
Wenn du das noch ein bisschen ausbaust, gehörst du schließlich zu den „Committed straight-queers- das sind jene, die Praktiken, die als „nicht-heterosexuell“ gelten, in ihr Sexualleben integriert haben. Das trifft nur auf wenige Männer zu, aber auch sie verdienen keine Etikettierung.
Mode und Körperpflege – typisch weiblich?
Die nächste Kategorie kennen wir nur zu genau: Ein durchschwitztes, oft gewaschenes und nicht gut sitzendes T-Shirt samt billigster, schon leicht fleckiger Jeans ist das, was der echte Mann tragen sollte. (Vergaß ich die Feinripp-Unterhosen?). Wenn du es nicht tust, kommst du in Verdacht, metrosexuell zu sein oder eben ein „Stylistic straight-queer“, die bunten Klamotten trägt, sich für Kunst interessiert und Körperpflegemittel verwendet. Merke: Ein richtiger Mann boxt, spiel Fußball und stinkt ab dem späten Nachmittag nach Schweiß. Tust du es nicht, steht dir bald auf der Stirn geschrieben, dass du ein Weichling oder Sitzpinkler bist. Oder mit anderen Worten: Ein Mann, der nicht auf das gängige Männlichkeitsideal passt.
Schattensexualitäten als Veranlagung?
Ei, ei – aller guten Dinge sind sechs. Nun folgt noch der Schattenmann. Der ist „eigentlich das Ideal eines Menschen, weil er keinem Klischee folgt. Oder im Sinne von Wikipedia: Männer, die sich zwischen Anpassung und Nicht-Anpassung an klassische männliche Rollenbilder befinden, ohne eine bewusste Entscheidung treffen zu können oder zu wollen, im Neo-Soziologen-Schnack „Males living in the shadow of masculinity“. Das heißt so ungefähr: Männer, deren Männlichkeit im Schatten lebt, aber nicht in den Vordergrund gestellt wird.
Wer sich als "echter Kerl" erweisen will, der hat nichts "Weibliches"?
Na, Mann, hast du dich als „echten Kerl“ vorgefunden? Dann bist du eisern „Hetero“ und PiV ist die einzige Art, in der du dich sexuell betätigst. Du sagst überall, dass du nichts gegen Schwule hast, aber wandelt sich der Satz so, dass du Schwule hasst. Natürlich hast du nie von einem Mann geschwärmt, nie seine Nähe genossen und deine Dreier (real oder in der Fantasie) waren immer MFF-Dreier. Dir hat niemand jemals auch nur einen Finger in den Anus gesteckt (auch keine Frau) und schon gar keine Plugs, Dildos oder so. Du liebst es, in Jeans oder gar im Trainingsanzug herumzulaufen, und du trägst Feinripp. Falls du ein „Schlipsträger“ bist, besitzt du zwei Krawatten und vier einfarbige Oberhemden. Du stets immer deinen Mann und weißt genau, was für einen Mann gut und richtig ist. Klar, dass du auch weißt, wie Frauen zu sein haben … oder?
Das Problem der Definition entstand mit dem Begriff "Heterosexualität"
Wie ich schon mehrfach erwähnt habe, entstand das Problem, Heterosexualität ständig neu definieren zu müssen, aus Abgrenzungsproblemen der Psychologen und Sozialwissenschaftler. Man kann sagen: Sobald die „Heterosexualität“ als Begriff erfunden wurde, musste sie ständig neu definiert werden. Da dies sogenannten „Heterosexuellen“ darin gar nicht interessiert sind, weil sie sich nicht angesprochen fühlen, versuchen Personen der sogenannten „Wissenschaften“, die selbst erzeugte Verwirrung durch neue Begriffe zu stützen – und damit abermals neue Verwirrungen hervorrufen.
Und eine Frage bleibt: Würde man die gleichen „Erkenntnisse“ auf sogenannte
Hetero-Frauen übertragen können? Wäre beispielsweise eine natürlich wirkende Frau, die sich weder schminkt noch betont modisch daherkommt, schon eine „non-stylistic straight-queer“ Person? Ist eine Installateurin schon ein Tomboy, weil sie sich für mehr für Technik interessiert als für Spitzenunterwäsche?
Oder ganz generell: Würde man eine sexuell selbstbewusste Frau, die einige durchaus sinnliche herb-männliche, verdeckte Eigenschaften hat, als „queer“ bezeichnen?
Vermutlich nicht.
Die Forschung: Hier eine Kurzfassung.
Die Interpretation im deutschen Wikipedia-Lexikon.
Das Thema erweitert und mit Kritikpunkten versehen: Englisches Wikipedia. Zusätzlich empfehle ich das Buch "Straight" von Hanne Blank, Boston 2012.