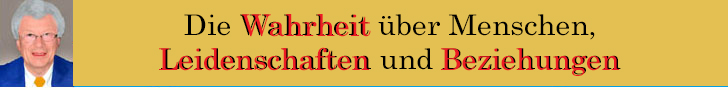Muss wirklich „alles anders werden“ im Zusammenleben?
Sehr viele Menschen in Deutschland behaupten, dass wieder alles anders werden müsste. Da nicht zu erwarten ist, dass sie dies vom kommenden Heiland erhoffen, sprechen sie davon, dass alles wieder besser wird, wenn es normal wird.
Das Muster „lebenslange Abhängigkeit“ als Modell für Beziehungen?
Normal war demnach alles, was auf Abhängigkeiten beruhte. Wenn wir einmal zurückblicken, begann die „Kennenlernkultur“ erst zu Beginn der Industrialisierung, also etwa seit Mitte des 19. Jahrhunderts.
Viele Jahrzehnte lang galt dann ein einfaches Muster: Der Mann heiratete und blieb mit dieser Frau zusammen, zog mit ihr Kinder auf und lebte nach den Regeln einer Konvention. Sie war so angelegt, dass eine lebenslange Abhängigkeit voneinander bestand. Und dazu kann man feststellen (Zitat, NZZ):
Bis in die 1960er - Mädchen heiraten sowieso mal
Das Erstaunliche daran ist, dass dieses Schema bis in die 1960er-Jahre in den meisten westlichen Industrieländern die Regel blieb. „Mädchen“ ergriffen zumeist sogenannte „Jungmädchenberufe“ – wenn es hochkam, durften einige das Gymnasium oder Lyzeum besuchen. Nach dem Abitur strebten diese jungen Frauen dann meist das Lehramt an – Frauen in gehobenen kaufmännischen oder technischen Berufen gab es äußert selten.
Was änderte sich wirklich?
Viele Autoren schrieben, dass „die Emanzipation“, als eine geistig-soziale Bewegung die Wende eingeleitet hätte. Ihre Worte in Ehren, aber das ist zu einfach gedacht. In Wahrheit waren es nicht die Emanzipationsgelüste, sondern die Möglichkeiten, mit einer besseren Berufsausbildung und stärkerem Einsatz im Beruf wesentlich mehr Geld zu verdienen.
Aus diesem Prozess ging die junge, emanzipierte und selbstbewusste Frau hervor, die sich selbst alles leisten konnte, was sie wollte – ein Mann war nicht nötig.
Zufrieden, frustriert oder hybrid?
Ein großer Teil der Frauen war damit zufrieden. Ein anderer Teil erreichte die erhofften Ziele nicht – der Weg zur „großen Karriere“ war sehr viel schwieriger als gedacht. Und wieder andere versuchten, ein hybrides Leben zu beginnen: Sie hatten sich vorgenommen, mit sich selbst zufrieden zu sein, suchten aber dennoch einen Mann, der in das „alte“ Rollensystem passt: also gebildeter, wohlhabender und angesehener zu sein.
Keine Lösungen, weil falsch gerechnet wird
Es ist offenkundig – dieses Verhalten funktioniert nicht. Wieder ist es der Markt, der die ihre Anspruchshaltung blockiert. Denn während es nun (2024) ausgesprochen viele gebildete, wohlhabende Frauen gibt, ist die Anzahl entsprechender Männer nicht gestiegen.
Das fördert einerseits den Frust solcher Frauen, andererseits aber auch die Unzufriedenheit „durchschnittlicher“ Männer.
Ein unlösbares Problem - es sei denn, wir ändern unsere Denkweise
Das Problem, das dahintersteht, gilt gegenwärtig als unlösbar. Jedenfalls kann es solange nicht gelöst werden, wie.
- Frauen darauf beharren, einen Anspruch auf einen gebildeteren/reicheren/angeseheneren Partner zu heiraten.
- Männer glauben, sie hätten per Naturrecht einen Anspruch auf eine Partnerin, um ihre Bedürfnisse und Lüste auszuleben.
Diejenigen, die sich immer noch „in der Mitte der Gesellschaft“ treffen und nicht so sehr auf Ausbildung, Reichtum oder Ansehen achten, sind zweifellos am erfolgreichsten bei der Partnersuche.
Und damit hättet ihr auch die Antwort. „In dieser Zeit“ haben wir keine andere Natur als zuvor, nur andere Denkmodelle. Und ob wir „zusammenpassen“ ist nicht am akademischen Grad erkennbar, sondern in der Art, wie wir das Leben betrachten.
Wer das einmal begriffen hat, der (oder die) kommt auch runter vom „hohen Ross“.
Zitat: NZZ, Schweizer Verhältnisse betreffend - aber in Deutschland haben wir die gleiche Situation.
Das Muster „lebenslange Abhängigkeit“ als Modell für Beziehungen?
Normal war demnach alles, was auf Abhängigkeiten beruhte. Wenn wir einmal zurückblicken, begann die „Kennenlernkultur“ erst zu Beginn der Industrialisierung, also etwa seit Mitte des 19. Jahrhunderts.
Viele Jahrzehnte lang galt dann ein einfaches Muster: Der Mann heiratete und blieb mit dieser Frau zusammen, zog mit ihr Kinder auf und lebte nach den Regeln einer Konvention. Sie war so angelegt, dass eine lebenslange Abhängigkeit voneinander bestand. Und dazu kann man feststellen (Zitat, NZZ):
Die Ehe war nicht der Liebe verpflichtet, sie diente der Stabilisierung der Gesellschaft und den Einzelnen dazu, den sozialen Status zu wahren.
Bis in die 1960er - Mädchen heiraten sowieso mal
Das Erstaunliche daran ist, dass dieses Schema bis in die 1960er-Jahre in den meisten westlichen Industrieländern die Regel blieb. „Mädchen“ ergriffen zumeist sogenannte „Jungmädchenberufe“ – wenn es hochkam, durften einige das Gymnasium oder Lyzeum besuchen. Nach dem Abitur strebten diese jungen Frauen dann meist das Lehramt an – Frauen in gehobenen kaufmännischen oder technischen Berufen gab es äußert selten.
Was änderte sich wirklich?
Viele Autoren schrieben, dass „die Emanzipation“, als eine geistig-soziale Bewegung die Wende eingeleitet hätte. Ihre Worte in Ehren, aber das ist zu einfach gedacht. In Wahrheit waren es nicht die Emanzipationsgelüste, sondern die Möglichkeiten, mit einer besseren Berufsausbildung und stärkerem Einsatz im Beruf wesentlich mehr Geld zu verdienen.
Aus diesem Prozess ging die junge, emanzipierte und selbstbewusste Frau hervor, die sich selbst alles leisten konnte, was sie wollte – ein Mann war nicht nötig.
Zufrieden, frustriert oder hybrid?
Ein großer Teil der Frauen war damit zufrieden. Ein anderer Teil erreichte die erhofften Ziele nicht – der Weg zur „großen Karriere“ war sehr viel schwieriger als gedacht. Und wieder andere versuchten, ein hybrides Leben zu beginnen: Sie hatten sich vorgenommen, mit sich selbst zufrieden zu sein, suchten aber dennoch einen Mann, der in das „alte“ Rollensystem passt: also gebildeter, wohlhabender und angesehener zu sein.
Keine Lösungen, weil falsch gerechnet wird
Es ist offenkundig – dieses Verhalten funktioniert nicht. Wieder ist es der Markt, der die ihre Anspruchshaltung blockiert. Denn während es nun (2024) ausgesprochen viele gebildete, wohlhabende Frauen gibt, ist die Anzahl entsprechender Männer nicht gestiegen.
Das fördert einerseits den Frust solcher Frauen, andererseits aber auch die Unzufriedenheit „durchschnittlicher“ Männer.
Ein unlösbares Problem - es sei denn, wir ändern unsere Denkweise
Das Problem, das dahintersteht, gilt gegenwärtig als unlösbar. Jedenfalls kann es solange nicht gelöst werden, wie.
- Frauen darauf beharren, einen Anspruch auf einen gebildeteren/reicheren/angeseheneren Partner zu heiraten.
- Männer glauben, sie hätten per Naturrecht einen Anspruch auf eine Partnerin, um ihre Bedürfnisse und Lüste auszuleben.
Diejenigen, die sich immer noch „in der Mitte der Gesellschaft“ treffen und nicht so sehr auf Ausbildung, Reichtum oder Ansehen achten, sind zweifellos am erfolgreichsten bei der Partnersuche.
Und damit hättet ihr auch die Antwort. „In dieser Zeit“ haben wir keine andere Natur als zuvor, nur andere Denkmodelle. Und ob wir „zusammenpassen“ ist nicht am akademischen Grad erkennbar, sondern in der Art, wie wir das Leben betrachten.
Wer das einmal begriffen hat, der (oder die) kommt auch runter vom „hohen Ross“.
Zitat: NZZ, Schweizer Verhältnisse betreffend - aber in Deutschland haben wir die gleiche Situation.